
Selbstbildnis mit Amor und Tod
Beschreibung
Während der Entstehung dieses Selbstbildnisses im Jahr 1875 lebte der damals 36-jährige Thoma in München, wo er sich im Umkreis Wilhelm Leibls und anderer Künstlerkollegen bewegte. Thoma stellt sich hier selbstbewusst als Künstler dar. Das hinter ihm stehende Skelett – im weißen Malerkittel und mit Lorbeerkranz auf dem Kopf – scheint dem Maler etwas ins Ohr zu raunen. Er hält inne, doch scheint ihn die Situation nicht allzu sehr zu verängstigen.
Thomas Selbstbildnis hat eine berühmte Vorlage bei dem symbolistischen Maler Arnold Böcklin. Dessen 1872 entstandenes Selbstbildnis mit fiedelndem Tod befindet sich heute in der Alten Nationalgalerie Berlin. Darin zeigt sich Böcklin selbst als Künstler, an den sich von hinten ein unheimliches Skelett schmiegt, das auf einer einsaitigen Geige spielt und den nachdenklichen Maler an seine Sterblichkeit erinnert. Diese Symbolik wird mit der lateinischen Umschreibung »memento mori« (»Bedenke, dass Du sterben wirst«) benannt.
Thoma hingegen geht es nicht primär um die eigene Sterblichkeit, sondern vielmehr um seinen über den Tod hinaus bestehenden Ruhm als Künstler. Auch der kleine Amor in der rechten oberen Bildecke mildert den Schrecken des Todes und wandelt die bedrohliche Symbolik des »memento mori« in ein »amor vincit omnia« (»Die Liebe besiegt alles«).
Thomas Selbstbewusstsein als Künstler gründete vermutlich weniger auf beruflichem Erfolg als auf privatem Glück. Denn 1875 war das Jahr, in dem er seine spätere Ehefrau Cella Berteneder kennenlernte. Die Beziehung zu ihr gab ihm inneren Halt und Selbstbewusstsein.
Hans Thoma als Künstler
0:00
0:00
Todesangst oder unendlich selbstbewusst?
Während der Entstehung dieses Selbstbildnisses im Jahr 1875 lebte der damals 36-jährige Thoma in München, wo er sich im Umkreis Wilhelm Leibls und anderer Künstlerkollegen bewegte.
Dort lernte er auch Arnold Böcklin kennen, einen bedeutenden Schweizer Maler des Symbolismus. Thoma, der sich vorher mehr auf bäuerliche Alltagsszenen und idyllische Motive aus dem Schwarzwald konzentriert hatte, war beeindruckt von Böcklins Kunst und ihren mythologischen Themen.
Der intensive Austausch mit dem zwölf Jahre älteren Böcklin und Thomas Bewunderung für dessen Kunst führten dazu, dass er Böcklins Bildideen in das eigene Werk integrierte. Doch Thoma übernahm nie das exakte Motiv, sondern variierte das Thema und interpretierte es neu.
memento mori - Bedenke, dass Du sterben wirst
Auch das Selbstbildnis mit Amor und Tod hat eine berühmte Vorlage bei Böcklin, Selbstbildnis mit fiedelndem Tod, das sich heute in der Alten Nationalgalerie in Berlin befindet. Darin zeigt sich Böcklin selbst als Künstler mit Pinsel und Palette. Von hinten schmiegt sich ein unheimliches Skelett an ihn, das auf einer einsaitigen Geige spielt.
Mit dieser Darstellung steht Böcklins Werk in der Tradition des mittelalterlichen Totentanzes. Bei diesem Bildtypus symbolisiert das Motiv des musizierenden und tanzenden Skeletts den Einfluss und die Macht des Todes über das Leben der Menschen. In Böcklins Gemälde erinnert der unablässige Klang aus dem Instrument des Skeletts den nachdenklichen Maler an seine Sterblichkeit.
Diese Symbolik wird mit der lateinischen Umschreibung „memento mori“ („Bedenke, dass Du sterben wirst“) benannt.
Vita brevis, ars longa - Das Leben ist kurz, die Kunst lang
Thoma griff die Bildidee in seinem drei Jahre später entstandenen Werk auf, nahm aber einige Änderungen an den Motiven und damit auch an der Gesamtaussage vor.
Auch Thoma zeigt sich selbst als Künstler, zu erkennen am Pinsel in seiner Hand. Das hinter ihm stehende Skelett im weißen Malerkittel trägt – statt einer Geige – einen Lorbeerkranz und scheint dem Maler etwas ins Ohr zu raunen.
Thoma scheint innezuhalten und über das Gesagte zu sinnieren. Doch anders als bei Böcklin scheint den Maler die Situation nicht allzu sehr zu verängstigen.
Das begründet sich auch in der veränderten Symbolik, die darauf hindeutet, dass es in Thomas Werk nicht nur um die eigene Sterblichkeit und Vergänglichkeit geht, sondern auch – angedeutet durch den Lorbeerkranz – um seinen über den Tod hinaus bestehenden Ruhm als Künstler.
amor vincit omnia - Die Liebe besiegt alles
Abgemildert wird der Schrecken des Todes zudem durch den kleinen Amor in der rechten oberen Bildecke, der seine Hand schützend über Thomas Kopf zu halten scheint. Seine Anwesenheit dämpft die bei Böcklin noch vorherrschende Dramatik und wandelt die bedrohliche Symbolik des „memento mori“ in ein „amor vincit omnia“ („Die Liebe besiegt alles“).
Thomas Selbstbewusstsein als Künstler, das in diesem Bild zum Ausdruck kommt, ist durchaus erstaunlich, denn zum Zeitpunkt der Entstehung war der junge Maler noch nicht besonders erfolgreich und in der damaligen Kunstmetropole München viel Kritik ausgesetzt. Seine Zuversicht und das Selbstvertrauen gründeten somit vermutlich weniger auf beruflichem Erfolg als auf privatem Glück.
Denn 1875 war das Jahr, in dem er Cella Berteneder kennenlernte. Die junge Frau war in München als Modell tätig und nahm bei Thoma Malunterricht. Die Beziehung zu Cella gab ihm inneren Halt und Selbstbewusstsein, und bereits 1877 heirateten Hans Thoma und die damals 19-jährige Cella. Manche wollen sogar im Gesicht des kleinen Putto Cellas Züge wiedererkennen, die Thoma vielfach porträtierte.
Nach Vollendung schenkte Thoma das Gemälde zunächst seinem engen Freund, dem Maler Louis Eysen, der es in seinem Testament wiederum Thoma vermachte. Dieser schenkte es 1910 dann der Kunsthalle.
Weitere digitale Angebote zu Hans Thomas „Selbstbildnis mit Amor und Tod“
Touren zu diesem Werk

Hans Thoma als Künstler
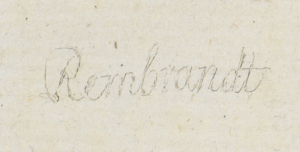
Who is who
Daten und Fakten
| Titel | Selbstbildnis mit Amor und Tod |
|---|---|
| Künstler*in | Hans Thoma |
| Entstehungszeit | 1875 |
| Inventarnummer | 1287 |
| Maße Bildträger | H 72,5 cm B 58,5 cm |
| Maße Rahmen | H 113,4 cm B 96,5 cm T 15,0 cm |
| Material | Leinwand |
| Technik | Ölfarbe |
| Gattung | Gemälde |
| Abteilung | Neue Malerei (nach 1800) |
-
Self Portrait. Renaissance to Contemporary
National Portrait Gallery 2005-2006, S. 147, Nr. 31
-
Hans Thoma
Kunsthalle Basel 1924, Nr. 49
-
19. Biennale Venedig
1934, Nr. 20
-
Hans Thoma, 1839-1924. Zum 100. Geburtstag
1939, Nr. 74
-
Hauptwerke der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe
Kunstverein St. Gallen 1947, Nr. 106
-
Hans Thoma und sein Kreis
1961-1962, Nr. 13
-
Schönheit und Geheimnis. Der deutsche Symbolismus 1870 - 1920
Kunsthalle Bielefeld 24.3.2013 - 7.7.2013
-
Autoportraits, de Rembrandt au selfie
-
Musée des Beaux-Arts de Lyon
-
Autoportraits, de Rembrandt au selfie
Musée des Beaux-Arts 25.03.2016-26.06.2016
-
Facing the World | Self-Portraits from Rembrandt to Ai Weiwei
Scottish National Portrait Gallery 16.7.2016 - 16.10.2016
-
Ich bin hier! Von Rembrandt zum Selfie
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe 31.10.2015 - 30.01.2016
-
Hans Thoma
Museum LA8 22.09.2017 ¿ 04.03.2018
-
Licht und Leinwand. Fotografie und Malerei im 19. Jahrhundert
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe 09.03.2019 - 02.06.2019
-
In the Picture: Portraying the Artist
Van Gogh Museum 21.02.2020 - 24.05.2020
-
Kunsthalle@ZKM. Ein neuer Blick auf die Sammlung
Highlight-Präsentation ZKM ab 29.04.2023
-
Hans Thoma - Ein Maler als Museumsdirektor
Studioausstellung ZKM 14.09.2024 - 02.02.2025
-
1980: Bildnisse aus dem 19. und 20. Jahrhundert im Besitz der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe
Hrsg.: Landesbildstelle Baden
Farblichtbildreihe zur Geschichte der Bildenden Kunst -
1988: Hans Thoma
Helmolt, Christa von
Spiegelbilder -
1989: Porträtmalerei
Hrsg.: Landesbildstelle Baden; Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
Aus dem Besitz der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe -
1989: Reihe "museum"
Hrsg.: Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
Westermann-Führer -
1993: Der Künstler und der Tod
Adolphs, Volker
Selbstdarstellungen in der Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts -
1991: Künstler rahmen ihre Bilder
Mendgen, Eva A.
Zur Geschichte des Bilderrahmens zwischen Akademie und Sezession -
1993: Auch die Toten werden vor dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein
Harris, Jonathan
-
1993: The anxious artist - ideological mobilisations of the self in German Modernism
Rogoff, Irit
-
1993: Hans Thoma (1839-1924)
Froitzheim, Eva-Marina
Ein Begleiter durch die Hans-Thoma-Sammlung in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe -
1995: Hans Thoma
Lauts, Jan
-
2000: Seelen Reich
Hrsg.: Ehrhardt, Ingrid; Reynolds, Simon
Die Entwicklung des deutschen Symbolismus 1870-1920 -
: German and Austrian Art. Part II, Christie's London
17.10.2000
-
2005: Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
Voigt, Kirsten Claudia
-
2006: Badisches Kalendarium
Von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr
-
2008: Vom Biedermeier zum Impressionismus
Kohle, Hubertus
-
2009: Briefe an Wilhelm Steinhausen, Hans Thoma und an seine Familie
Eysen, Loui; Hrsg.: Vogel, Wilhelm Dieter
-
1971: Katalog Neuere Meister
Hrsg.: Staatliche Kunsthalle Karlsruhe; Bearb.: Lauts, Jan
19. und 20. Jahrhundert -
1971: Katalog Neuere Meister
Hrsg.: Staatliche Kunsthalle Karlsruhe; Bearb.: Lauts, Jan
19. und 20. Jahrhundert -
1903/04: Kunst für Alle
XIX
-
2012: Baden-württembergische Erinnerungsorte
Weber, Reinhold [Hrsg.]
-
2013: Schönheit und Geheimnis - Der deutsche Symbolismus :
Hülsewig-Johnen, Jutta
Die andere Moderne [... Ausstellung "Schönheit und Geheimnis. Der deutsche Symbolismus - Die andere Moderne", Kunsthalle Bielefeld, 24. März bis 7. Juli 2013] -
: Hans Thoma - Wanderer zwischen den Welten /
Winzen, Matthias; Thoma, Hans
-
2019: Licht und Leinwand
Beiersdorf, Leonie; Großmann, G. Ulrich; Müller-Tamm, Pia
Fotografie und Malerei im 19. Jahrhundert -
2020: In the picture
Bakker, Nienke; Smit, Lisa
portraying the artists -
2018: Oskar Zwintscher - zwischen Symbolismus und Neuer Sachlichkeit
Majerczyk, Janina
Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag -
2015: Ich bin hier!
Müller-Tamm, Pia (Hg.); Schäfer, Dorit (Hg.)
Von Rembrandt zum Selfie
